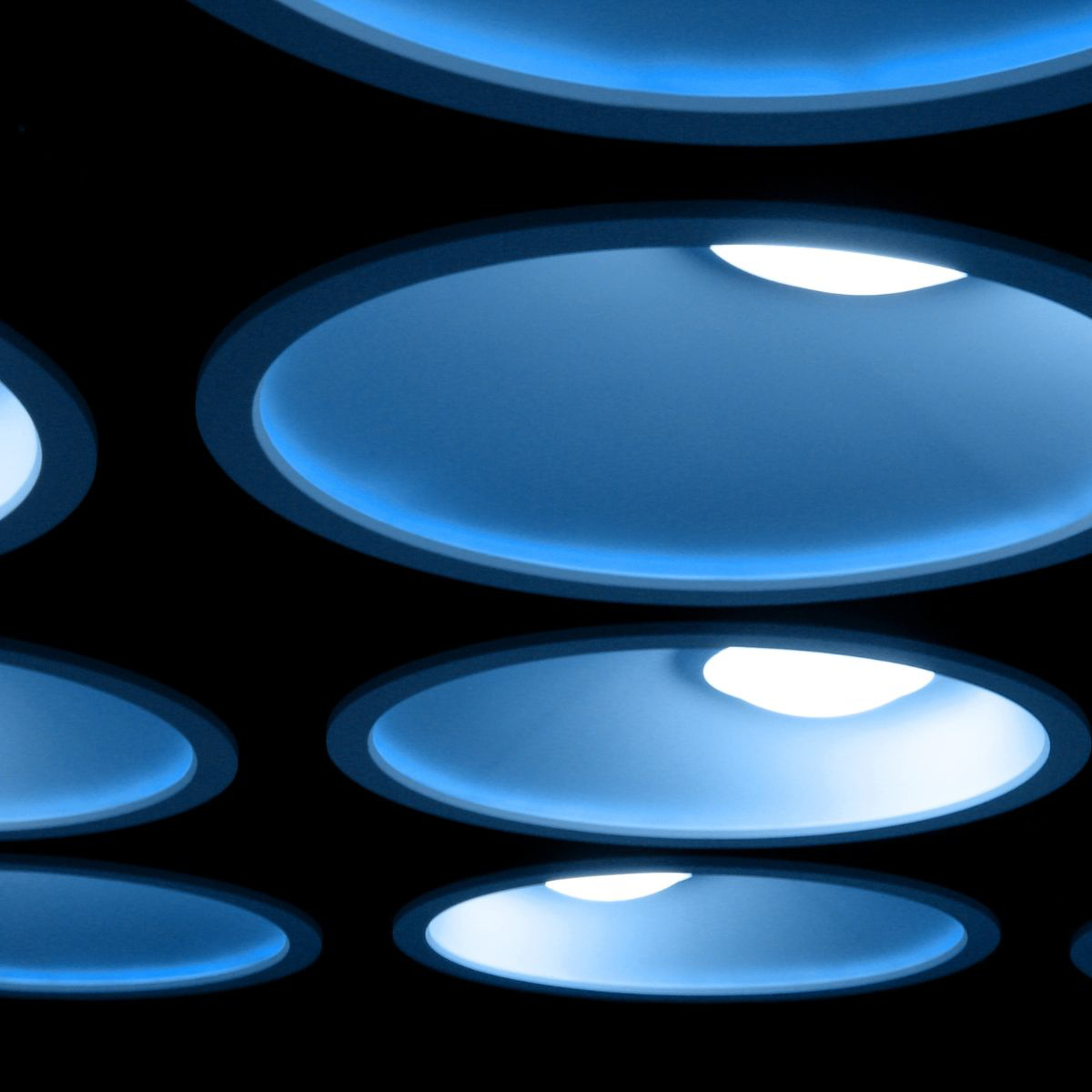Lesedauer: 5 Minuten

Herr Avermaete, zu Ihren Aufgaben an der ETH Zürich gehört, künftigen Architektinnen und Architekten die Geschichte des Städtebaus zu erklären. Was möchten Sie der jungen Generation mitgeben?
Für mich lehrt uns die Architekturgeschichte zweierlei: Erstens müssen wir dringend aufhören, Baumaterial um den Globus zu transportieren. Beschränken wir uns doch wieder auf regionale Ressourcen, wie es unsere Vorfahren getan haben. Das Baumaterial für das historische Brüssel zum Beispiel wurde im Umkreis von nur rund 30 Kilometern beschafft. Wir dagegen verbauen Mitten in Europa Naturstein aus China – das ist völlig verrückt.
Zweitens wünsche ich mir, dass wir zu einer Kultur des Reparierens und Wiederverwendens zurückfinden, die uns im Westen mit der industriellen Massenproduktion und dem Massenkonsum abhandengekommen ist: Während in der Antike, im Mittelalter oder der Renaissance stets Vorhandenes als Basis für Neues genutzt wurde, haben wir Architektur zur Wegwerfware degradiert und verlernt, Dinge zu flicken oder anzupassen. Der Philosoph und Kulturkritiker Ivan Illich sagte es richtig: Wir müssen uns diese Fähigkeit unbedingt wieder aneignen.
Die Architekturgeschichte lehrt uns, verantwortungsvoll zu bauen?
Architekturgeschichtliches Wissen ist heute wertvoller denn je: Um eine menschen- und umweltfreundliche Baukultur zu etablieren, müssen wir alle ein bisschen Historiker sein.
Bislang wird die Architekturgeschichte aber meistens als Geschichte der großen Ideen und Genies erzählt. Wie die Menschen früher mit Ressourcen umgingen, spielt genauso selten eine Rolle wie die gesellschaftlichen Konstellationen, die die bauliche Entwicklung von Städten steuerten.
Momentan vollzieht sich ein grundlegender Perspektivenwechsel: Aus der Ideengeschichte wird eine reziproke Geschichtsschreibung. Wenn wir Architekturhistorikerinnen und -historiker uns heute mit Bauten und Städten beschäftigen, fragen wir nach den Ressourcen, aus denen sie entstanden sind – also nach Baumaterialien, Wissen und Handwerkstechniken, aber auch nach topografischen und klimatischen Rahmenbedingungen sowie gesellschaftlichen Verhältnissen. Wenn wir so über die Vergangenheit nachdenken, können wir sehr viel lernen. Darum überarbeiten wir am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur gerade unser Vorlesungsprogramm.
Schon jetzt besprechen Sie in Ihren Grundlagenvorlesungen umweltfreundliche Architekturexperimente aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Diese Anlagen nahmen vieles vorweg: die Nutzung der Solarenergie etwa oder das Bauen mit Altteilen.
Diese Projekte sind kaum bekannt oder sogar gänzlich in Vergessenheit geraten. Unsere Disziplin leidet zuweilen unter Amnesie. Das ist schade: Wir halten uns damit auf, Experimente zu wiederholen, statt von den Erfahrungen der Vergangenheit zu profitieren.
Inwiefern unterscheidet sich die heutige Umweltdebatte von jener der 1970er-Jahre?
Die 70er markieren zwar einen ersten Höhepunkt des Ökologiediskurses, doch die Projekte von damals waren nur als Testobjekte gedacht. Anders als die heutige Generation hatten die Architektinnen und Architekten noch nicht den Anspruch, nachhaltiges Bauen zum neuen Normal zu machen.
Warum ist eine tiefgreifende Veränderung der Baupraxis so schwierig?
Die Kluft zwischen akademischer Welt und Politik ist tief. Aber für die Bauwende brauchen wir nicht nur Forschung und kreative Ideen, sondern vor allem auch engagierte Politikerinnen und Politiker: Wir müssen Normen und Baugesetze so anpassen, dass sie die Weiternutzung des Bestandes nicht behindern und die Wiederverwendung von Bauteilen begünstigen. Noch setzen wir falsche Prioritäten: Pritzker-Preisträgerin Anne Lacaton sagte mir erst kürzlich, hier in der Schweiz würden viele ihrer Re-Use-Ideen an Komfortnormen scheitern. Zusätzlich tut politischer Druck auf die Industrie not, damit Bauprodukte langlebiger werden und sich leichter reparieren lassen.

Sie treiben noch einen Perspektivenwechsel voran: die Dekolonialisierung der Architekturgeschichte.
Über Generationen haben wir so getan, als seien alle Innovationen in Architektur und Städtebau von Europa und Nordamerika ausgegangen. Das war unglaublich ignorant. Es ist ein großer Gewinn, anders auf die Geschichte zu blicken – ganz besonders angesichts des Klimawandels: Der globale Süden lehrt uns mit seiner traditionellen Architektur, wie man mit Hitze fertig wird. Und die Menschen dort können uns wieder beibringen, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Denn sie sind viel weniger vom Massenkonsum geprägt als wir und verstehen noch, Dinge zu reparieren und Vorhandenes zu nutzen. Nicht aus Zufall beschäftigen sich Büros wie BC architects aus Brüssel, die klimagerecht und sparsam bauen wollen, verstärkt mit der Baukultur südlicher Länder.
Die Schweiz besaß nie Kolonien. Trotzdem forschen Sie mit Ihrem Team zur Schweizer Kolonialgeschichte.
Die Schweiz ist tief verstrickt: Schweizer Geschäftsleute, Unternehmen, Ingenieure oder Architekten waren in den Kolonien anderer europäischer Länder aktiv und profitierten von der Ausbeutung. In Zürich verkauften Geschäfte Kolonialwaren, und die berühmten Schweizer Schokoladenfabriken verarbeiteten Kakao und Zucker aus den Kolonien. Geblieben sind von dieser Zeit bauliche Zeugen wie die prunkvolle Villa Patumbah, deren Erbauer Karl Fürchtegott Grob mit Tabakplantagen auf Sumatra einer der reichsten Männer der Schweiz wurde.
Seit 2023 sind in unserem Forschungsstudio interessante Arbeiten zur Schweizer Architektur in der Kolonialzeit entstanden: Deepthi Puthenpurackal zum Beispiel untersuchte die Bauten der Basler Mission im indischen Kannur. Die Missionare waren auch Geschäftsleute und verdienten an Kolonialwaren wie Textilien. Rémi Madrona erforschte unterdessen Fabriken und Arbeiterquartiere des Schokoladenproduzenten Suchard in Genf und Neuchâtel sowie dessen Plantagen in Sabana del Mar in der Dominikanischen Republik.
In der Vergangenheit kam es nicht gut an, verschwiegene Kapitel der Schweizer Geschichte aufzuarbeiten: Die Bergier-Kommission wurde für ihre Untersuchung der Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg und zum Verbleib jüdischen Vermögens bei Schweizer Banken angefeindet. Geht es Ihnen ähnlich?
Die Zeiten haben sich geändert: Heute besteht ein großes Interesse auch an den düsteren Teilen der Schweizer Geschichte. Viele Menschen wollen sich damit auseinandersetzen.
Wir stoßen auf andere Widerstände: Manchmal bleiben uns Archive verschlossen oder verstrickte Institutionen und Unternehmen machen nur einen Teil der Quellen zugänglich. Auch verschwundenes Archivmaterial bereitet uns Schwierigkeiten: Pläne oder Schriftstücke, von denen wir wissen, dass sie existiert haben, sind plötzlich nicht mehr auffindbar. Dann müssen die Forschenden aus anderem Material aufwendig ein Bild zusammenpuzzeln.
Einige Menschen allerdings halten die Präsenz problematischer historischer Artefakten nicht aus. Sie wollen Statuen entfernen oder Häuser und Straßen umbenennen.
Ich finde das falsch. Es ist sogar gefährlich, historische Zeugnisse aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Fehler dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Stattdessen brauchen wir eine kritische Erinnerungskultur. Es gibt viele Möglichkeiten, produktiv mit belasteten Relikten umzugehen – sei es, indem man Erklärungstexte anbringt oder durch künstlerische Aktionen.
Ein differenzierter Umgang mit Geschichte funktioniert aber nur in einer offenen Gesellschaft.
Und deswegen mache ich mir große Sorgen: Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in meinem Heimatland Belgien sind neuerdings immer mehr Menschen unfähig, Meinungskonflikte zu ertragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte es zur politischen Kultur Europas, Widerspruch zu tolerieren und sich mit abweichenden Standpunkten auseinanderzusetzen. Doch heute wird schnell in Extremen gedacht: Plötzlich scheint nichts mehr denkbar zwischen der Monumentalisierung der Vergangenheit oder der Auslöschung aller Erinnerungen.
Management Summary
Jetzt reinhören: Ihre Management Summary im Audio-Format.