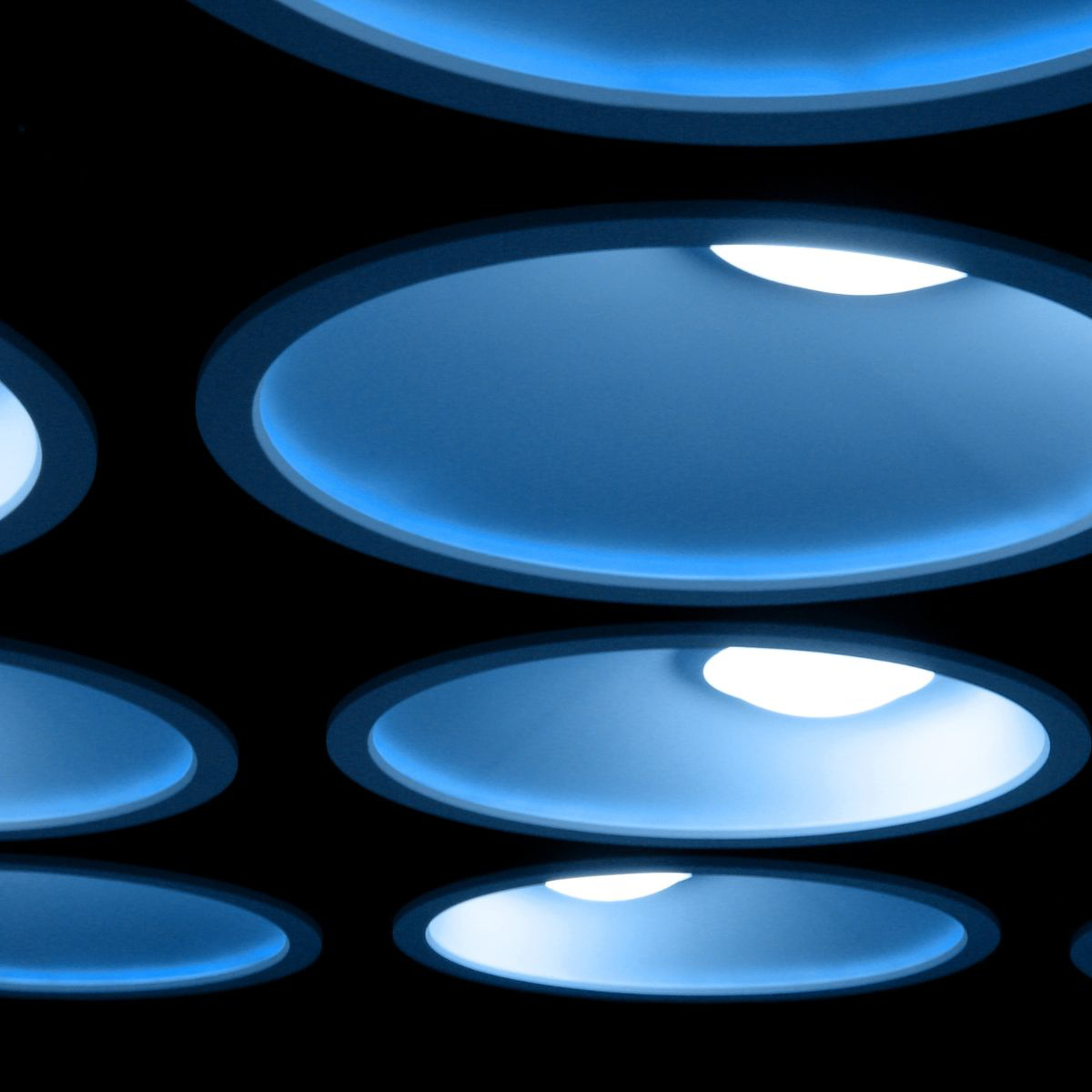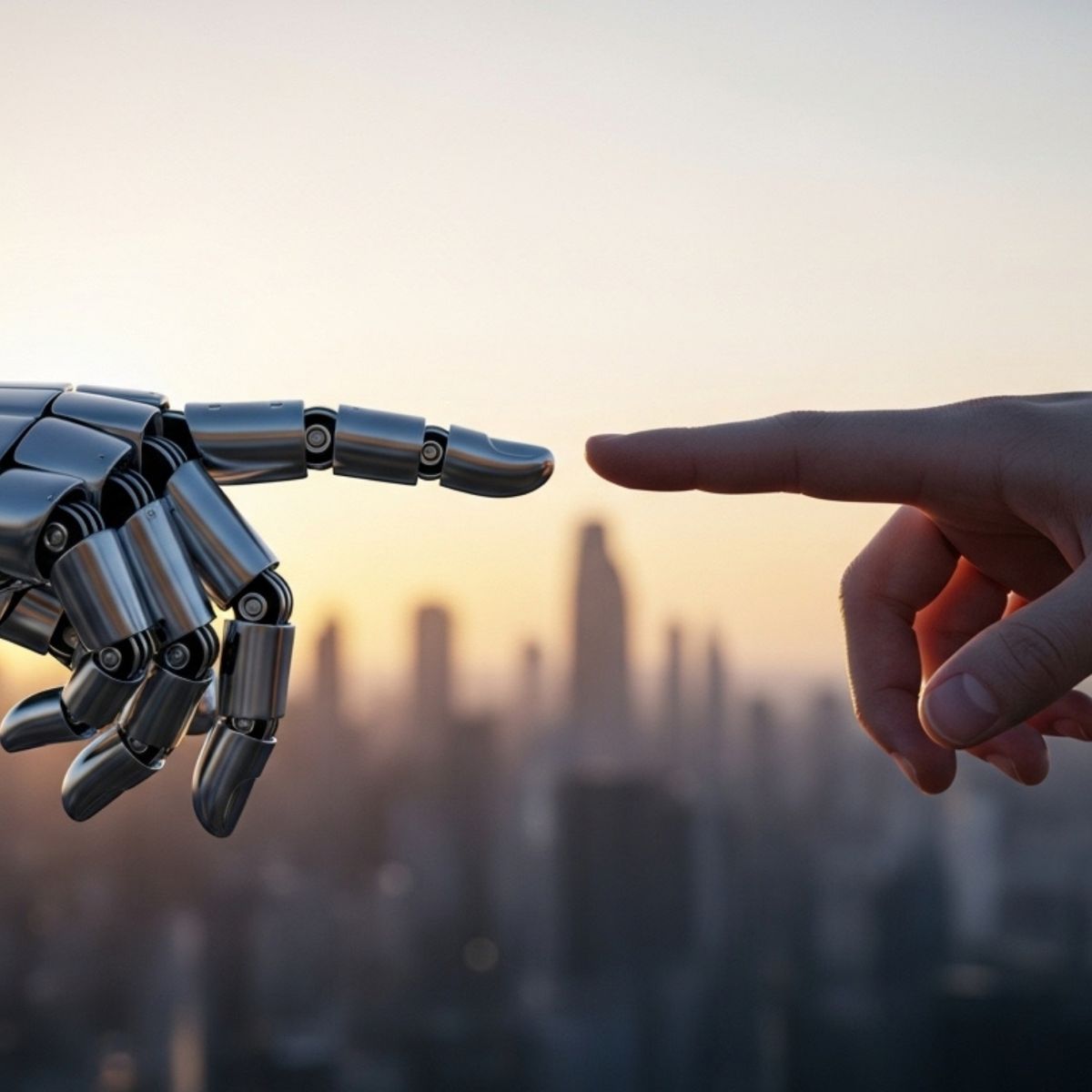Lesedauer: 8 Minuten
Ein Planungsbüro ist im besten Fall nicht nur ein Dienstleister, der Entwürfe erstellt und technische Lösungen entwickelt, sondern fungiert auch als Koordinator, Innovationsmotor und zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für Bauherr*innen, Generalunternehmer*innen und die öffentliche Hand. In diesem Artikel aus der Serie Building Perspectives erläutert unser Autor Michael Wanka aus seiner Sicht, wie ein integriertes Gebäudemanagement und eine gezielte Auswahl der Planungspartner*innen Silodenken verhindert und eine zügige Projektabwicklung im Rahmen des Budgets ermöglicht. Er greift dabei auf seine langjährige und professionelle Erfahrung im Projektgeschäft eines internationalen Unternehmens für Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik zurück und zeigt, wie eine Planung in Kooperation mit Planungsbüros dafür sorgt, dass Projekte effizient, nachhaltig und zukunftsorientiert realisiert werden.
Aufgaben eines Planungsbüros
- Projektentwicklung: Das Planungsbüro begleitet den gesamten Prozess von der ersten Idee bis zum fertigen Konzept.
- Entwurfsplanung: Es erstellt Skizzen, Entwürfe, Baupläne und digitale Modelle.
- Genehmigungsplanung: Alle notwendigen Unterlagen für Baugenehmigungen und behördliche Zustimmungen werden vorbereitet.
- Ausführungsplanung: Die Pläne werden detailliert ausgearbeitet und bilden die Grundlage für die Bauausführung.
- Kostenschätzung und -kontrolle: Die Projektkosten werden kalkuliert und das Budget überwacht.
- Bauüberwachung und Projektsteuerung: Die Bauausführung wird kontrolliert, die beteiligten Firmen koordiniert und die Einhaltung von Qualitätsstandards sowie Zeitplänen sichergestellt.
Systemlieferanten unterstützen den Planer dabei, die neuesten und innovativsten Technologien in die Projekte einzubringen, um einen effizienten und nachhaltigen Gebäudebetrieb zu gewährleisten. Es ist sinnvoll, eine echte vertrauenswürdige Partnerschaft zwischen Planer*innen, Systemanbieter*innen und Endkund*innen zu etablieren. Der sogenannte Triangle-Effekt beschreibt das partnerschaftliche Zusammenarbeiten unter Führung des Planungsbüros, um die Anforderungen der Endkund*innen zu vertreten und umzusetzen sowie technische Innovationen zu integrieren.
Die Herausforderung
Bereits die Vergabe der planerischen Leistungen für Bauvorhaben, die alle HOAI-Leistungsphasen 1 bis 9 umfasst, stellt eine wesentliche Herausforderung dar. Die HOAI-Leistungsphasen 1-9 beziehen sich auf die neun klar definierten Projektphasen gemäß der Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen (HOAI) in Deutschland. Sie strukturieren den gesamten Planungs- und Bauprozess eines Projekts von der ersten Idee bis zur Fertigstellung, Qualitätssicherung und Übergabe.
Durch die Vergabe aller HOAI-Leistungsphasen 1-9 an ein einziges Planungsbüro kann sichergestellt werden, dass sämtliche Planungs- und Überwachungsleistungen aus einer Hand erfolgen und Schnittstellenprobleme minimiert werden. In der Praxis kommt es allerdings auch sehr häufig vor, dass einzelne Planungsphasen an verschiedene Planungsbüros vergeben werden. Das kann bei Änderungen im Prozess dazu führen, dass sich ein Planungsbüro wieder in die Planung des Vorgängerbüros einarbeiten muss oder sogar eine neue Planung erstellen muss, was letztlich viel Zeit kostet und die Fertigstellung verzögert. Für die Auftraggeber*innen ist das nicht kosteneffizient und der Planer verfolgt möglicherweise eine andere Strategie wie z.B. Hang zu Minimallösungen, um Kosten zu sparen und Budgetüberschreitungen. Auch durch den gesteigerten Zeitdruck können innovative Technologien für den späteren nachhaltigen und smarten Gebäudebetrieb wegfallen und es entstehen weiterhin wieder viele Gewerke-Silos.
Eine umfassende integrale Planung der Leistungsphasen 1 bis 9 (LPH 1-9) kann durch die Beauftragung eines einzelnen Planungsbüros effizient sichergestellt werden. Im Vorfeld ist es jedoch unerlässlich, die fachliche Qualifikation und Kompetenz des ausgewählten Büros sorgfältig zu überprüfen. Verfügt das Büro über die erforderlichen Kompetenzen für ein integriertes Gebäudemanagement in den Kostengruppen 480 (Gebäudeautomation) und 450 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen), oder sind die Qualifikationen auf nur eine der beiden Kostengruppen beschränkt? Ist letzteres der Fall, so sollte ein weiteres kompetentes Planungsbüro hinzugezogen werden, um das Bauvorhaben partnerschaftlich zu beginnen und sich regelmäßig abzustimmen, gewerkeübergreifende Funktionen zu koordinieren und den Projekterfolg zu sichern.
Organisatorische Herausforderungen und die Vorteile einer integralen Planung
Die Vorteile einer integralen Planung liegen vor allem in Effizienz, Transparenz, Kosteneinsparung, Innovation und Qualitätssicherung während des gesamten Bauprozesses. Werden alle HOAI-Leistungsphasen nur an ein einziges, kompetentes Planungsbüro vergeben, lassen sich Schnittstellenprobleme weitgehend vermeiden, da sämtliche Planungsleistungen aus einer Hand stammen. Das führt zu einer besseren Abstimmung der einzelnen Gewerke in den jeweiligen Kostengruppen wie Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik und ermöglicht eine frühzeitige Berücksichtigung innovativer Technologien sowie smarter Lösungen für den späteren effizienten und nachhaltigen Gebäudebetrieb.
Ein weiterer Vorteil ist die klare Verantwortlichkeit: Die Endkund*innen haben einen festen Ansprechpartner*in, was die Kommunikation vereinfacht und die Koordination von Änderungswünschen und technischen Anforderungen erleichtert. Zudem kann durch die integrale Planung das Kosten- und Terminmanagement optimiert werden, da ein durchgängiger Überblick über alle Projektphasen besteht und Fehler oder Doppelarbeiten vermieden werden. Die ganzheitliche Betrachtung fördert außerdem die interdisziplinäre Zusammenarbeit und steigert die Qualität und Nachhaltigkeit des fertigen Gebäudes. Schnittstellenprobleme, die sich speziell zwischen den Kostengruppen 480 und 450 ergeben, können konstruktiv mit allen Projektbeteiligten in einer frühen Phase des Bauvorhabens abgestimmt werden. In der Praxis wird dies jedoch häufig nur teilweise oder gar nicht umgesetzt. Nachträgliche Änderungen der Planung sind mit nicht zu unterschätzenden Kosten verbunden, die im Budget meist nicht eingeplant sind.
Ein integraler Planungsansatz führt nicht zwangsläufig zu vollständiger Einigkeit; es können auch organisatorische Herausforderungen auftreten, etwa Aussagen wie „das brauchen wir nicht“ oder „dafür steht kein ausreichendes Personal zur Verfügung“. Häufig entstehen hierbei Diskussionen über Zuständigkeiten sowie Verantwortlichkeiten und Budgets innerhalb der Organisation. Eine gewerkeübergreifende Zusammenarbeit ist jedoch notwendig, um die Vorteile einer integralen Planung ausschöpfen zu können.
Technische Herausforderungen und Hindernisse einer integralen Planung
Ein integraler planerischer Ansatz bietet wie beschrieben viele Vorteile. Es gibt andererseits im Bereich der Technologie für integriertes Gebäudemanagement derzeit aber auch zu wenige Standards und offene kostengünstige Schnittstellen zwischen den Gewerken eines digitalen Gebäudes.
Die Gebäudeautomation ist ein zentraler Bestandteil moderner Gebäudetechnik und ermöglicht die intelligente Steuerung und Überwachung verschiedenster Anlagen wie Heizung, Lüftung, Klima, Einzelraumregelung, Beleuchtung und Sicherheitssysteme. Besonders auf der Feldebene, wo Sensoren und Aktoren direkt mit der Gebäudesteuerung verbunden sind, ist die Auswahl der passenden Kommunikationsprotokolle entscheidend. Die Vielzahl an Technologien wie OPC, BACnet MSTP, M-Bus oder proprietären Bussystemen erschwert oft die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Herstellern. Ohne einheitliche offene Standards sind immer wieder kostenintensive Schnittstellen oder pflegeintensive Gateways (Soft- und Hardware) notwendig, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten und die Vorteile umfassender Gebäudeautomation voll auszuschöpfen.
Um die Effizienz und den Nutzen der Gebäudeautomation zu maximieren, ist es wichtig, bereits in der Planungsphase auf offene und standardisierte Schnittstellen zu achten. So können zukünftige Erweiterungen oder Anpassungen leichter umgesetzt werden und die Integration verschiedener Gewerke gelingt reibungsloser. Eine vorausschauende Planung fördert nicht nur die technische Funktionalität, sondern trägt auch maßgeblich zur Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit des Gebäudebetriebs bei.
Ein Trend in der Gebäudeautomation, der zur Digitalisierung beiträgt, ist die Integration drahtloser Technologien wie: Bluetooth, Zigbee, WLAN, Z-Wave, LoRaWAN. Bluetooth bietet auf der Feldebene flexible Möglichkeiten, insbesondere in der Einzelraumregelung Sensoren (Raumthermostate), Aktoren (z.B. Ventile), Fensterkontakte, Beleuchtung kabellos mit der Gebäudesteuerung zu verbinden. Das erleichtert die Nachrüstung und Erweiterung bestehender Systeme, da keine aufwendige Verkabelung notwendig ist. Bluetooth ermöglicht eine effiziente und sichere Kommunikation über kurze Distanzen und kann bei Bedarf mit anderen Funkstandards über Gateways kombiniert werden, um eine optimale Abdeckung und Interoperabilität zu erreichen. Durch den Einsatz von Bluetooth-Technologien können Wartungsarbeiten vereinfacht und die Skalierbarkeit der Gebäudeautomation verbessert werden. Zudem wird durch drahtlose Technologien die Brandlast durch konventionelle Schwachstromverkabelung deutlich reduziert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt und das Brandrisiko wesentlich beeinflusst.
Allerdings bringen drahtlose Technologien wie Bluetooth auch Risiken mit sich. Durch Funktechnologien entsteht eine potenzielle Angriffsfläche für Cyberattacken. Die kriminelle Energie ist heutzutage nahezu grenzenlos, sodass auch Gebäude und deren Infrastruktur gefährdet sind und auf sensible Daten zugegriffen werden kann. Dies muss bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden. Zwar sind alle Hersteller*innen bemüht, ihre Systeme mit der neuesten und sichersten Hard- und Software Sicherheitsstandards auszustatten, dennoch sollten diese Themen in der integralen Planung aufgenommen und entsprechend berücksichtigt werden.
Integrale Planung in der Sicherheitstechnik (KG-450)
Gerade im Bereich der Sicherheitstechnik ist eine integrale Planung besonders wichtig, da hier oft verschiedene Systeme wie Zutrittskontrolle (ZKS), Videomanagementsystem (VMS), Einbruchmeldeanlagen (EMA), Brandmeldetechnik (BMA), Flucht- und Rettungswegetechnik (FTT), Sprachalarmanlage (SAA) miteinander vernetzt werden müssen. Das Zusammenspiel sollte gewährleistet sein, um die Vorteile der Integration effizient zu nutzen und Menschen sowie Gebäude zu schützen. Die Realität zeigt jedoch, dass es im Bereich der Sicherheitstechnik kaum Standards gibt, um eine Interoperabilität zwischen der Brandmeldetechnik und Zutrittskontrolle verschiedener Hersteller zu realisieren.
Ziel muss sein, die Brandmeldetechnik von Hersteller A mit der Zutrittskontrolle von Hersteller B über das Managementsystem so zu verknüpfen, dass im Brandfall die Türen der Zutrittskontrolle geöffnet werden und über die Sprachalarmanlage von Hersteller C die Personen im kritischen Bereich des Gebäudes gewarnt werden können. Die Feuerwehr könnte vor dem Einsatz im Sicherheitsleitstand mit der Videokamera den gefährdeten Bereich einsehen, um gezielt den Brand zu bekämpfen. Auch könnten aktuelle Feuerwehrlaufkarten digital bereitgestellt oder ausgedruckt werden. Letztendlich sollte es im Interesse der Kund*innen sein, alle Prozesse zum Schutz von Menschen und Infrastruktur im Bedarfsfall zu einem Workflow zusammen zu fassen und über das Managementsystem abzubilden.
Dies gilt selbstverständlich auch für andere Gewerke. Es stellt sich die Frage, weshalb nicht ebenfalls im Bereich der Sicherheitstechnik eine Einigung auf einen offenen Standard wie BACnet oder ONVIF (vor allem im Videobereich angewendet) erfolgt. Hier sollte das Planungsbüro bereits im Vorfeld mit den Auftraggeber*innen abstimmen, welche Funktionen gefordert oder gewünscht sind, um Unstimmigkeiten auszuräumen und Zeit sowie Geld zu sparen.
Eine frühzeitige Abstimmung und die Auswahl offener Schnittstellen ermöglichen nicht nur eine reibungslose Integration in die Gebäudeautomation, sondern erhöhen auch den Schutz vor unbefugtem Zugriff und verbessern die Reaktionsfähigkeit im Notfall. Durch die ganzheitliche Betrachtung der Sicherheitstechnik innerhalb der integralen Planung können Synergien genutzt, Redundanzen vermieden und das Sicherheitsniveau nachhaltig gesteigert werden. Es ist zudem entscheidend, auch Aspekte wie Datenschutz und IT-Sicherheit in die Planung einzubeziehen, um die Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen und die gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Organisatorische Vorteile eines integrierten Managementsystems
Durch ein übergeordnetes gewerkeübergreifendes Managementsystem oder einen Leitstand mit einheitlichem Look & Feel kann das Risiko von Fehlbedienungen in Stresssituationen durch eine einheitliche Benutzeroberfläche weitgehend vermieden werden. Das Situationsbewusstsein wird verbessert, der Platzbedarf reduziert, die Datendurchgängigkeit erhöht, die Lageerkennung beschleunigt und Maßnahmen können schneller eingeleitet werden. Der Informationsfluss wird optimiert und die Reaktionszeiten bei kritischen Infrastrukturen wie Rechenzentren, Labors oder Industrieanlagen verkürzt. Sollte dies nicht gelingen, ist festzustellen, dass die Personalkosten weiter ansteigen und Kunden mit einer geringeren Anzahl an Fachkräften für anspruchsvolle Gebäudetechnik auskommen müssen.
Vernetzt. Integriert. Smart.
Ein konventionelles Gebäudemanagement basiert auf separaten Anwendungen für Betrieb, Überwachung und Optimierung von HLK-Anlagen, Energiemanagement, Brandmeldetechnik sowie Kontroll- und Beleuchtungssystemen. Die Nachteile sind ein mangelnder Informationsfluss, verlängerte Reaktionszeiten im Notfall und höhere Betriebskosten. Eine Integration hingegen vereint die verschiedenen Gewerke einer Liegenschaft in einer intelligenten Lösung, in „einem Fenster“. Die Vorteile sind offensichtlich: Die Anwender*innen erhalten einen unternehmensweiten Überblick über die Daten und die Reaktionsabläufe können automatisiert werden. So lässt sich die Produktivität bei verbesserter Sicherheit steigern.
Man muss wissen, dass 75% bis 80% der Gesamtkosten einer Liegenschaft während des Betriebs entstehen. Es lohnt sich also, frühzeitig die richtigen Weichen für niedrige Betriebskosten zu stellen. Ein gewerkeübergreifender Ansatz erfordert koordinierte Planung, zahlt sich aber durch niedrige Wartungs- und Energiekosten aus.
Global betrachtet hat zum Beispiel Honeywell Building Solutions bereits mehr als 4.000 Energieeinsparprojekte durchgeführt und dabei Einsparungen von über 3 Milliarden Euro für die Kund*innen erzielt.
Management Summary
Jetzt reinhören: Ihre Management Summary im Audio-Format.
Light + Building 2026: Impulse für morgen
Mehr zur Zukunft der gebauten Welt erfahren Sie auf der Light + Building 2026. Vom 8. bis 13. März 2026 zeigt die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik in Frankfurt am Main, wie Energieeffizienz, digitale Vernetzung und Lichtgestaltung Innovationen in der Branche vorantreiben – gebündelt in den Top-Themen Sustainable Transformation, Smart Connectivity und Living Light.