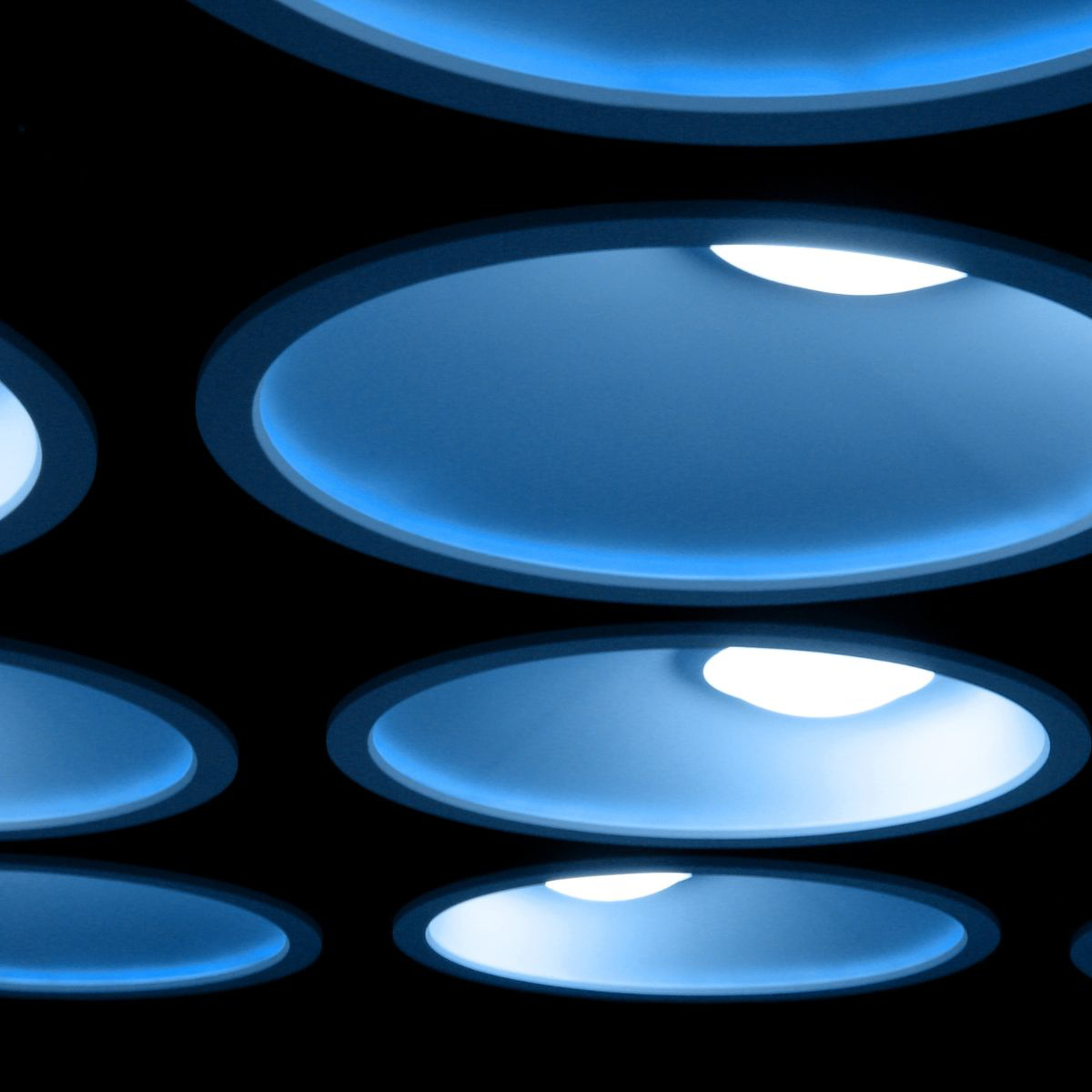Lesedauer: 7 Minuten
Gabriela Beck: Um die Zukunftsfähigkeit einer Stadt messen zu können, wurde am Fraunhofer Institut der Morgenstadt City Index entwickelt. Um was geht es da?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Der Morgenstadt City Index ist ein Werkzeug, um die Komplexität von Städten greifbar zu machen. Es wird immer noch zu viel in einzelnen Sektoren gedacht und geplant: Energiesysteme werden weiterentwickelt, Mobilität, Versorgung – aber es wird nicht übergreifend gehandelt. Dabei sind Städte Systeme, in denen viele Prozesse gleichzeitig ablaufen und sich gegenseitig beeinflussen. Der Morgenstadt City Index beinhaltet 28 Indikatoren, die in vier Säulen kategorisiert sind (lebenswerte, umweltgerechte, innovative und resiliente Stadt). Durch ihre grafische Darstellung liefern sie auf einen Blick ein erstes ganzheitliches Bild einer Stadt. Der Index dient als Instrument Bürgermeister, Stadträte und Stakeholder bei der nachhaltigen Transformation ihrer Stadt zu unterstützen.
Städte sind also komplexe adaptive Systeme. Was sind die größten Herausforderungen, wenn es darum geht sie zukunftsfähig zu machen?
Dr.-Ing. Steffen Braun: In erster Linie geht es natürlich um die Lebensqualität, um den Menschen. Allerdings werden künftig im Kontext des Klimawandels Umweltparameter eine noch stärkere Rolle spielen. Will eine Stadt innovativ sein, muss sie sich mit dem Thema Wertschöpfung ansässiger Unternehmen beschäftigen, vor allem aktuell betreffend Digitalisierung und Einsatz von KI. Hier verändern sich gerade ganze Branchen, was Fragen aufwirft wie: Setze ich noch klassisch auf produzierende Industrie oder muss ich neue Tech-Branchen ansiedeln? Dann geht es auch um die Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen im Hinblick auf eine älter werdende Gesellschaft. Das Entscheidende ist meiner Meinung nach jedoch, überhaupt handlungsfähig zu werden. Wie kommt eine Stadt im Zusammenspiel verschiedenster Entscheider und Entscheiderinnen überhaupt schnell in einen kontinuierlichen Veränderungsmodus?
Sie meinen, Transformationsprozesse laufen zu langsam ab?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Genau, Städte sind sehr träge Systeme, wenn es um Veränderung geht. Aber das ist nicht allein die Schuld der Städte, denn die befinden sich auf der untersten föderalen Ebene und müssen sich mit zahlreichen Zielkonflikten auseinandersetzen. Darüber sind die Länder angesiedelt, die Regionalparlamente, der Bund und auch die EU – alle definieren Vorgaben und Gesetze. Und trotzdem können und sollten wir schneller für die Städte von morgen werden.
Wo sehen Sie hier Potenzial?
Dr.-Ing. Steffen Braun: GovTech (Government Technology) kann uns voranbringen, also der Einsatz moderner Technologien durch Regierungen und öffentlichen Stellen zur Verbesserung von staatlichen Dienstleistungen, Beschleunigung von Verwaltungsprozessen und der Partizipation bzw. Interaktion mit Unternehmen, Bürgern und Bürgerinnen. Bisher wurde das sehr stark auf der staatlichen Ebene gedacht, doch wir haben gemerkt, dass zum Beispiel KI auch für die Kommunen immer wichtiger wird, etwa in Form von intelligenten Datenplattformen, die auf Knopfdruck ressortübergreifend alle möglichen Informationen zur Verfügung stellen. Immer mehr Städte in Deutschland setzen auch auf digitale Zwillinge, also virtuelle Abbilder, die auf Echtzeitdaten basieren und für Analysen, Simulationen und Vorhersagen verwendet werden können. Damit lassen sich zum Beispiel Verflechtungen von Energie und Transport aufzeigen oder Lösungen für ein besseres Wassermanagement oder auch Sozialfaktoren eines Quartiers abbilden.
Wie technologieaffin sind Deutschlands Städte im Vergleich zu anderen Ländern?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Vor allem die Digitalisierung der Verwaltung und Smart-City-Initiativen haben erst seit wenigen Jahren die Aufmerksamkeit erhalten, die sie bräuchten. Andere Städte in Europa sind da schon deutlich länger unterwegs und experimentieren inzwischen sogar mit dem Metaverse.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Das urbane Metaverse ist die Weiterentwicklung des digitalen Zwillings. Anstatt nur von außen draufzuschauen, können wir die virtuelle Stadtumgebung jetzt auch begehen, Stichwort Virtual Reality. Seoul war einer der Vorreiter. Seit ein paar Jahren hat die Stadt ein virtuelles Rathaus, dessen Dienstleistungen man mit einem Avatar rund um die Uhr nutzen kann, zum Beispiel um einen neuen Ausweis zu bestellen. Solche neuen Anwendungsfälle gilt es aber auch zu gestalten, damit diese Zukunftstechnologien die urbanen Säulen Lebensqualität, Umweltgerechtigkeit und Innovationsfähigkeit stärken und sich am Ende nicht einfach Tech-Konzerne daran bereichern. Und auch das Thema Daten- und Cybersicherheit müssen die Verantwortlichen besser verstehen lernen.
Smarte Technik für eine effizientere Steuerung und bessere politische Entscheidungen ist das eine. Wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Im Verbundprojekt Future District Alliance forschen wir mit führenden Quartiersentwicklern und Kommunen daran, wie man Stadtteilplanung beschleunigen kann. Die Vision für uns: Genehmigungsprozesse und Bauweisen mittels KI und Automatisierung so zu ändern, dass man ein gesamtes Quartier statt wie bislang in zehn Jahren in zwei Jahren realisieren oder transformieren kann, mit allen Abläufen. Wir sind dabei, ein Konzept für einen Quartierstyp Z zu entwickeln – Z für Zukunft. Analog dem Gebäudetyp E, der auf Vereinfachung setzt, indem er vor allem auf nicht unbedingt erforderliche Ausstattungs- und Komfortstandards verzichtet, um Bauprojekte schneller und kostengünstiger voranzubringen. Einen ähnlichen Ansatz benötigen wir auf der Ebene des Quartiers. Letztlich lassen sich damit auch größere Ziele zum Erhalt des urbanen Lebensraums besser erfüllen. Ich denke da Richtung Klimaneutralität oder Daseinsvorsorge.
Apropos Lebensraum, wie schaffen wir es, unsere Städte und damit das Wohnumfeld von 78 Prozent der Deutschen gegen Starkregenereignisse und längere Hitzeperioden zu wappnen?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Wir bauen immer noch zu viele Betonwüsten und zugepflasterte Plätze. Denn wir planen das Stadtgefüge meist nutzungsorientiert – Wohnen, Gewerbe, Mobilität – und machen uns erst im Nachhinein Gedanken darüber, wie sich das Ganze etwas nachhaltiger in den "Zwischenräumen" gestalten ließe. Ich plädiere für ein anderes Verständnis von Flächennutzung, bei dem das Zusammenspiel von grüner Infrastruktur und gebauter Umgebung mehr Bedeutung bekommen muss. Auch die Einsatzpotenziale aller urbanen Oberflächen sollten stärker berücksichtigt werden. Entsiegelung und Begrünung ist essenziell, wenn es um die Aufnahmefähigkeit von Starkregen oder die Klimaregulierung über Verdunstung geht. Und wir müssen stärker dreidimensional denken, denn Fassaden und Dächer werden in diesem Kontext künftig eine tragende Rolle spielen.
Wie überzeugen Sie Investoren und Stakeholder von der Übernahme möglicher Mehrkosten aufgrund von Klimaanpassungsmaßnahmen?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Man muss ehrlich bilanzieren. Wenn man potenzielle Folgekosten durch unterlassene Maßnahmen dazurechnet, sieht das Ergebnis meist ganz anders aus. Dann ist es plötzlich auch ökonomisch sinnvoll, Projekte klimaresilient umzusetzen und auch neue Konzepte und Ideen auszuprobieren. Die Bereitschaft dazu ist da. Das sehen wir an unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Der Hintergrund: Lange Zeit war die Immobilienwirtschaft marktgetragen – die Preise sind immer nur gestiegen. Da musste man als Investor nicht viel nachdenken, sage ich jetzt mal. Doch das funktioniert nur noch bedingt. Denn der Markt hat sich inzwischen bereinigt.
Möchte eine Stadt attraktiv sein oder bleiben, muss sie sich also etwas ausdenken. Was bedeutet in diesem Zusammenhang innovationsfähig?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Es gibt Städte, die zufällig oder eben nicht zufällig immer die ersten waren, Neues zu implementieren. London zum Beispiel war die erste Stadt der Welt, die eine U-Bahn erfunden und eingesetzt hat – das war einzigartig und hoch innovativ. Zu jener Zeit wusste keiner, was das ist. Der Gedanke dahinter: Wir können Tunnel bauen und wir haben die Eisenbahn erfunden. Warum packen wir das nicht zusammen unter die Erde? Die Frage ist: Will ich den Status quo erhalten oder etwas Neues ausprobieren? Das hat früher wie heute viel mit Offenheit gegenüber Trends und Technik zu tun und mit der engen Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, lokaler Wirtschaft und Forschungseinrichtungen. Kopenhagen zum Beispiel versteht sich als Reallabor und die Stadtquartiere als Testfeld für neue Lösungen.

Können Sie uns ein paar Best Practice-Beispiele aus Deutschland nennen?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Es gibt tolle Quartiersprojekte im Netzwerk der Future District Alliance, die vorbildhaft für eine übergeordnete Transformation von Städten sind. Zum Beispiel das nutzungsgemischte Kreativquartier Werksviertel Mitte auf dem ehemaligen Pfanni-Produktionsgelände in München oder das energetisch autarke Technologiestadtquartier Behrens-Ufer Berlin oder auch die Frankfurt Westside mit ihrem innovativen Energiekonzept, basierend auf dezentraler Stromerzeugung durch Photovoltaik auf Dachflächen und Fassaden sowie auf der Nutzung der Abwärme von Rechenzentren für die Beheizung des Quartiers. Energie wird in Zukunft eines der Schlüsselthemen sein.
Das waren jetzt alles Beispiele aus Großstädten. Was ist mit den Mittel- und Kleinstädten?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Wir haben aus meiner Sicht in Deutschland vitale Städtenetzwerke von vielen kleinen, mittleren und großen Kommunen in jedem Bundesland, die sich eng abstimmen. Und an den vom Bund geförderten 73 Modellprojekten Smart Cities sehen wir, dass auch in Gemeinden mit nur ein paar tausend Einwohnern kreative Lösungen entstehen können. In vielen Orten und Regionen herrscht Aufbruchstimmung. Das macht Mut.
Spielen internationale Städtepartnerschaften in Zukunft noch eine Rolle?
Dr.-Ing. Steffen Braun: Ich halte diese Partnerschaften für unglaublich wertvoll, da sie Synergien schaffen – sei es hinsichtlich des Implementierens neuer Technologien, der Organisation von Abläufen oder der finanziellen Kooperation. Allerdings sollten wir diese anders denken und leben für die gemeinsame Transformation. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, man kann Aufgaben auch aufteilen und Ressourcen gemeinsam nutzen. Dieser Netzwerk-Ansatz wird in Deutschland in manchen Förderprogrammen schon umgesetzt, er könnte aber auf europäischer oder internationaler Ebene noch intensiviert werden. Darum engagieren wir uns auch in innovativen Stadtprojekten wie MasColonia in Uruguay, weil wir hier große Kooperationspotenziale zwischen Südamerika und Europa sehen – vor allem angesichts der aktuellen globalen Verschiebungen. Schließlich hat Europa starke Städte mit viel Lebensqualität – ein Merkmal, das wir schätzen sollten. Nicht zuletzt würde es dem europäischen Gemeinschaftsgedanken gut anstehen.
Dr.-Ing. Steffen Braun…
…ist seit 2024 stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Zuvor war er langjähriger Leiter des Forschungsbereichs »Stadtsystem-Gestaltung« am Fraunhofer IAO sowie Mitbegründer der Fraunhofer-Initiative Morgenstadt. Im Fokus seiner angewandten Forschung steht die Frage, wie sich Städte und urbane Systeme klimagerecht, technologieoffen und anpassungsfähig gestalten lassen.
Die Fraunhofer-Initiative Morgenstadt
Im Jahr 2011 haben sich Fraunhofer-Experten aus unterschiedlichen Themen- und Anwendungsfeldern zusammengeschlossen, um Städte auf ihrem Weg zu mehr Innovation zu unterstützen.
Mehr erfahrenMorgenstadt: City Insights
In dem Verbundforschungsprojekt bündeln zehn Fraunhofer-Institute sowie weitere 37 Partner aus Städten, Kommunen und Industrie ihre Kompetenzen und bieten Städten diverse Formen der Unterstützung für eine nachhaltige Stadtentwicklung an.
Mehr erfahrenFuture District Alliance
Um die Zukunft von Quartieren aktiv mitzugestalten und Impulse für das Morgen weiterzugeben, gründete das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) 2022 das Innovationsnetzwerk Future District Alliance. Gemeinsam mit Partnern der Immobilienwirtschaft, Städten, Startups und Technologienanbietern soll eine gemeinsame Vision entwickelt werden, durch die Kombination aus wissenschaftlicher Expertise, Anwendungsforschung und unternehmerischer Kompetenz.
Mehr erfahren